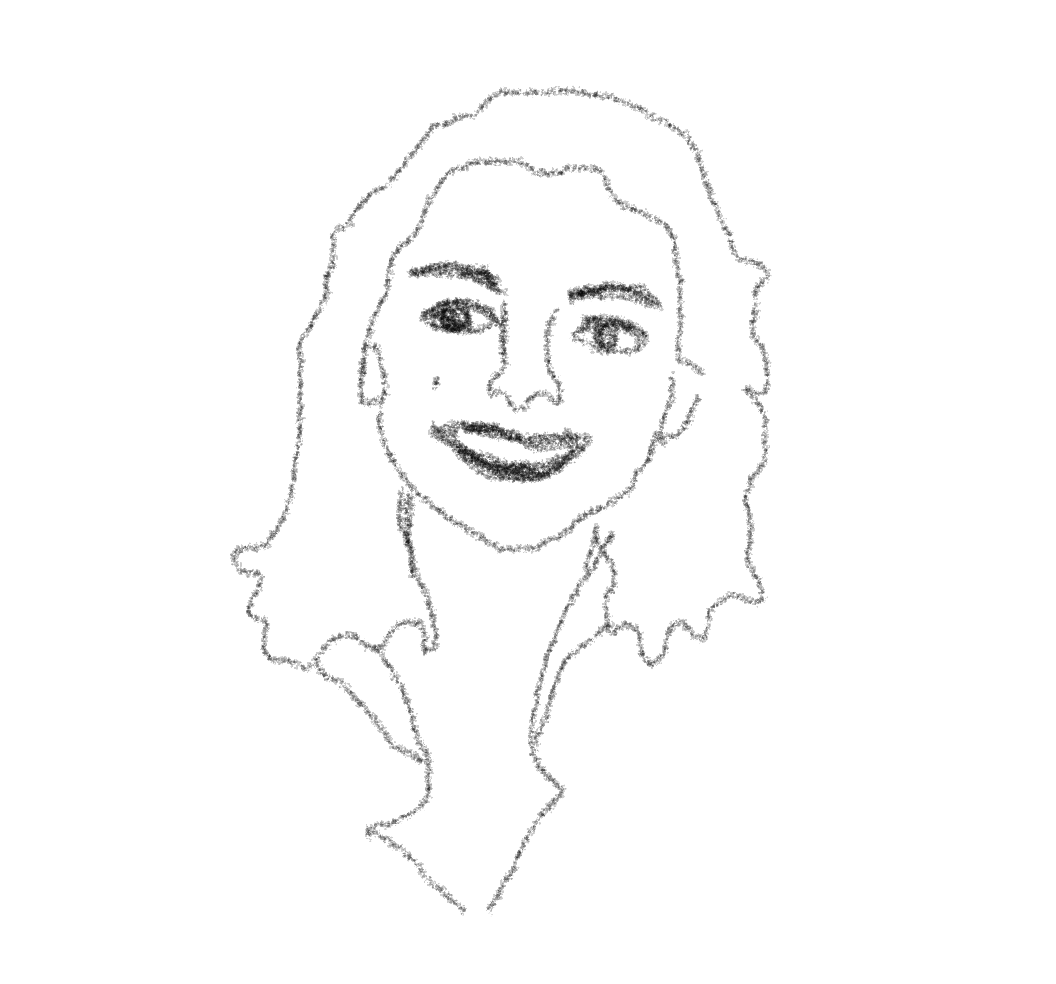Knoten im Kopf
Jeder Mensch hat sein eigenes individuelles Buch zu schreiben. Es beginnt bei allen mit der Geburt und endet mit dem Tod. Trotz dessen ist jede Geschichte eine andere. Einige Bücher sind dicker, andere dünner. Einige Kapitel länger, andere kürzer. Bei manchen ist die Schriftart bunt, bei anderen schwarz weiß. Und nur wir haben die Macht unsere Kapitel umzuschreiben.
Amelie hatte sieben lange Jahre ihre Kapitel überwiegend in schwarz weiß geschrieben. Eine Odyssee der Gefühle über Phasen der Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Wut und Einsamkeit. Begleitet wird Sie von der zweithäufigsten Volkskrankheit der Welt, der Depression.
„Jeder Mensch hat seine Knoten im Kopf, die einen feste, die anderen lockere, die einen nur einen, die anderen ein ganzes Netz. Man muss lernen die Knoten frühzeitig lösen zu können, um nichts Schwerwiegendes in dem Netz gefangen zu halten“, sagte sie
Amelie Kraus, 19, hat dunkelbraune schulterlange Haare, ein hübsches Gesicht und eine starke, willenskräftige Ausstrahlung. Ihre poolblauen Augen spiegeln Ihre Gefühlswelt wider. Sie ist ordentlich gekleidet. Amelie ist die jüngste von vier Kindern. Auf dem Land groß geworden ist Ihre Kindheit mit den Kindern aus Bullerbü zu vergleich. Die Zeit ihrer Jugend, welche Sie zum größten Teil im Internat verbrachte, macht Hanni und Nanni Konkurrenz. Trotz dessen ist dies nur das äußere Erscheinungsbild, denn innerlich ist Ihre Welt mit keinem fröhlichen Kinderfilm zu vergleichen.
Vor drei Stunden wurde Amelie vom Rettungsdienst abgeholt. Die Route ging ins Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, auch genannt UKE. Die Fahrt dauerte 10 Minuten. Das Krankenhaus ist hoch angesehen und landet sogar auf dem Platz 3 der besten Krankenhäuser Deutschlands.
Sie sitzt nun im Wartezimmer der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Die Wände sind kahl und weiß gehalten, es hängt gerade mal ein kleines Bild über dem Wartestuhl ihres Gegenübers. Es ist ein abstraktes Werk, bestehend aus allen möglichen Cremefarben. Die feinen Pinselstriche, zwischen den harten Spachtelmassen, kommen einem im Gegensatz wie Zuckerwatte vor. Die Atmosphäre ähnelt einem aufreißenden Wolkenhimmel. Den Blick ein bisschen herunter gleitend, stechen die blauen Stühle, die einzige Farbe im Raum, ins Auge. Das blau ist sanft, beruhigend und weckt Assoziationen zum Himmel, dem Meer, zu Ferne und Weite. Psychologisch taktisch klug gestaltet. Amelie probiert den gesamten Raum mit jedem Geschehen, jeder Bewegung und allen Geräuschen in sich aufzusaugen. Hauptsache Ihr Puls kommt jetzt nicht wieder einem aktiven Leitungssportler zu nahe. Denn, so höher Ihr Puls ist, desto weniger kann Sie Ihre Panikattacken kontrollieren und wenn die Panikattacke erst einmal da ist, kommt Sie da nicht so schnell wieder raus.
So gefangen in Ihren Gedanken hat Amelie nicht bemerkt, dass der Arzt aus seinem Sprechzimmer auf sie zugekommen war, nun neben Ihr steht und Sie schon zum wiederholtesten mal mit Ihrem Namen anspricht. Die restlichen Wartenden hatten Ihren Blick nun auch auf Sie gerichtet, wartend auf Ihre Reaktion, horchend ob Sie die Frau Kraus ist. Jedoch um Scham oder Pein zu verspüren, kreisten sich Ihre Überlegungen und Gefühle zu sehr. Sie stand nun auf und folgte dem Arzt ins Zimmer.
Auch dieses Zimmer ist schlicht gestaltet. Wieder hängt nur ein einziges Bild an der Wand, wahrscheinlich sogar vom gleichen Künstler. Die Züge und Strukturen sind identisch mit dem Bild im Wartebereich. Der einzige Unterschied scheinen die Farben zu sein, Blautöne. Dafür sind die drei Stühle, zwei vor dem Schreibtisch, einer hinter dem Schreibtisch, in einer Cremefarbe. In dem weißen, deckenhohen, Schrank ist nur das mittlere Regal, ohne Schranktür, einsehbar. Dort stehen alle möglichen psychologischen und medizinischen Bücher, sortiert nach Größe und Farbe. Ein Patient mit Ordnungszwang könnte sich hier mit Sicherheit wohlfühlen. Amelie hingegen fühlt sich genau deswegen unwohl, das Zimmer ist nur für die Patienten eingerichtet und sie ist gerade zu einem Patienten geworden. Der Arzt schaut Sie noch ein paar lange Sekunden an, probiert wahrscheinlich Ihre Emotionen zu lesen und sortiert schon einmal im Kopf seinen ersten Satz. „Frau Kraus, was fühlen Sie gerade?“, fragte er.
Wie soll Amelie am besten Ihre Gefühle beschreiben, wenn sie selber nicht mehr weiß was sie fühlt. Es ist schon lange her, dass sie ihre Gefühle einzeln beschreiben konnte. Es gibt für sie nicht mehr die reine Freude ohne die darauffolgende Trauer. Es gibt nicht mehr den Schmerz, ohne die Benommenheit. Und es gibt nicht mehr ihren Mut ohne die Unsicherheit. Am schlimmsten war die erste starke depressive Phase, zu Beginn der neunten Klasse. Sie wurde, wie auch Ihre Geschwister zuvor, auf das Internat Torgelow geschickt um eine bessere Bildung als in ihrem Dorf zu erhalten. Dort begann es schlimmer und schlimmer zu werden. Selber ist Ihr der Trigger für die schlechten Phasen nicht bekannt, sie vermutet nur durch Anhäufungen mehrerer negativer Geschehnisse. Die ersten Monate auf dem Internat vergingen und Ihr Zustand wurde zunehmend schlechter. Jeder Morgen ist für Sie ein Kampf aufzustehen. Jeder Tag eine Hürde ihn durchzuhalten. Es sollten mit die besten Jahre im Leben sein, die Jugendzeit. Die Zeit in der man lernt Verantwortung für sich und seine Mitmenschen zu übernehmen und seine ganz eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Man fühlt sich in dieser Zeit mächtig, frei, wild und unbesiegbar. So wird zumindest die Jugend beschrieben. Amelie beobachtet viel. Sie sieht ihre Schulkameraden und Mitbewohner enggepaart über die Flure laufend, lachend, freundschaftlich kloppend und auch die ersten Verliebten flirtend, in die Pause laufen. Sie schaut der Klasse den langen Korridor hinunter, hinterher. Es wird auf einmal lauthals gelacht, denn einem der Jungs wurde ein Bein gestellt und ist fast zu Boden gegangen. Über dieses Gelächter denkt Amelie noch lange nach. Warum schafft sie es einfach nicht aus dem Herzen mitzulachen. Was genau ist falsch mit ihr. Würde sie sich jetzt noch in schwarz anziehen, würde sie sich wahrscheinlich selber als Dracula bezeichnen, ohne jegliche schöne Ausstrahlung. Sie fragte sich, wann überhaupt das letzte Mal war, wo sie einen Lachkrampf verspürte. An das Gefühl kann sie sich noch erinnern. Der ganze Körper zitternd, den Bauch kribbelnd, schon fast schmerzend und die Wangenmuskeln im Lachen versteift. Jetzt kann sie hauptsächlich nur Wut, Trauer und die Panik vor dem Leben, Ungewissheit vor Ihrer Zukunft, welche sie momentan nicht sieht, spüren. Im Kopf stellt sie sich ein mächtiges Männlein vor, das nach Aufmerksamkeit schreit. Sie fühlt sich unwohl sowie in ihrer äußerlichen Erscheinungsform, als auch im Inneren mit ihrer krankhaften Persönlichkeit. Die Gedanken dieser Benommenheit und zugleich den starken depressiven Gefühlen ein Ende zu setzen kommt immer häufiger. Amelie schämt sich sehr für ihre Suizid Gedanken, denn im Grunde genommen sollte ihr Leben doch erfüllt sein, außerdem liebt sie ihre Familie sehr, sie kann sie nicht einfach so im Stich lassen. Das war der Moment, in welchem sie sich so sehr gehasst hatte und so einen innerlichen Druck verspürte, dass sie anfing sich selber zu bestrafen.
Es begann mit einem gestörten Essverhältnis, damit wenigstens die Hülle Ihres Körpers den gesellschaftlichen Vorstellungen gerecht wird. Das Gefühl des Hungerns und der Essenszunahme gab ihr ein bestimmtes Machtgefühl.
An ganz schlimmen Tagen fängt sie nun auch an sich selber zu verletzen. Bedacht fügt sie sich ihre Wunden auf dem Oberschenkel mit einer Rasierklinge, nahe der V-Linie, zu. Auch hier verspürt sie wieder die Macht über ihren Körper und einen gewissen Druckausgleich. Die Momente kurz davor werden aus psychologischer Sicht als dissoziativer Stupor beschrieben. Denn die persönliche Grenze ist so weit überschritten, dass man keine emotionale Reaktion mehr spürt und seiner Gefühle nicht mehr bewusst ist. Amelie probiert dadurch wieder zurück in die Gegenwart zu gelangen. „Man will nicht das andere die Narben sehen und ebenso möchte man sich nicht verpacken und verstecken“, beschrieb Sie die Platzierung ihrer Verletzungen. Es gab Monate, da verletzte sie sich täglich.
Das räuspern des Arztes holt Sie wieder zurück in die Gegenwart. Er fragt ob Sie wüsste warum Sie von ihrem Hausarzt mit einem Krankenwagen abgeholt wurde. Ohne auf Ihre Antwort zu warten, welche ihr wahrscheinlich eh im Hals stecken geblieben wäre, beschrieb er den Grund. Der Besuch bei ihrem Hausarzt wegen ihrer, bis dahin noch sogenannten “Panikattacke“, das dadurch viel zu schnell schlagende Herz und ihrem Geständnis der Suizidgedanken, führte dazu ihre Lage das erste Mal seit sechs Jahren für selbstgefährdet zu halten. „Suizid ist ein Mord an sich selber und um solch einen Mord zu verhindern, probiert der Staat mit möglichst viel Sicherheit daran zu gehen, um so etwas zu vermeiden“, erklärte er mit einem einfühlsamen und verständnisvollen Gesicht. Daraufhin gab er ihr Flyer für die verschiedensten Psychosomatischen Kliniken. Ihr erster Gedanke dazu war, dass sie sowas nicht verdient. Die Menschen die dorthin gehen, denen geht es viel schlechter als ihr und einen freien Platz wollte sie auch keinem nehmen.
Es ist beinahe ein Jahr vergangen, als Amelie sich für einen Aufenthalt in der Medizinisch-Psychosomatischen Klinik Bad Bramstedt umentschied. Es war der Moment, als ihre Mutter sie vom Dach holte und aufgelöst sagte, dass sie nicht mehr weiterweiß. Für ein Kind oder Jugendlichen ist das eine Seltenheit zu hören, denn bisher sind Eltern die Allwissenden.
Drei Monate nach dem Aufenthalt in der Klinik ist Amelie wie ausgewechselt. Sie versteht nun woher ihre Probleme kamen. Hat akzeptiert, dass es eine Krankheit ist, die man mit psychologischer Hilfe bewältigen kann und der Platz für sie in der Klinik genauso berechtigt war, wie für jeden anderen. Sie begreift nun wie sie selber mit sich umgehen muss. Hat gelernt sich zu lieben und auf ihre Seele aufzupassen. Gibt anderen zu verstehen, wie man mit ihr umgehen soll, wenn eine kleine unstabile Phase wieder auftreten sollte. Sie war 14 Jahre alt als alles begann und hat erst mit 20 Jahren wieder zu sich, zu ihrer Freude und zu ihrem Glück gefunden. Sie ist eine Kämpferin und hört damit auch nicht auf, denn sie weiß, dass sie immer weiter an sich arbeiten muss, so wie jeder andere es auch tun sollte.
„Die Herausforderung des Lebens ist, dass man nur zurückblickend das Leben versteht, aber es vorwärts leben muss. Man kann es nur verständlicher machen, wenn man über alles offen redet. Ich hätte mir damals sehr gewünscht zu wissen, dass der Fehler nicht direkt an mir liegt. Das Problem ist, die Menschen verschweigen es, wenn es ihnen psychisch nicht gut geht, sie schämen sich. Anderen scheint es auch gut zu gehen, ist der Gedanke. Psychische Probleme werden noch zu sehr als Schwäche verstanden. Das bekannte Steinzeitmotto “Survival of the fittest“, ist wiederzuerkennen. Wir müssen den Punkt knacken, an welchem es zur Normalität wird, nicht nur bei physischen Problemen zum Arzt zu gehen, sondern auch bei psychischen. Das Problem kann fast immer erkannt und behandelt werden“, empfiehlt sie und lächelt aufmunternd.